Alternative Ökobeton?
Beton ist aus unserer gebauten Umwelt nicht wegzudenken. Neben seiner enormen statischen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit sind es vor allem die guten Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften, die den Einsatz von Beton fördern.
Auf den ersten Blick stellt die großzügige Verwendung (weltweit ca. 12 Milliarden Kubikmeter) kein Problem dar, da der Stoff i. d. R. zu etwa 90 % aus natürlichen Zutaten wie Wasser, Sand und Kies besteht. Doch das Bindemittel Zement und der Stahl verschlingen bei ihrer Herstellung ungeheure Mengen an Energie und damit 8 % der weltweiten CO2-Emissionen. Etwa 1.450 °C werden benötigt, um aus Ton und gemahlenem Kalkstein Zementklinker zu brennen, bei Stahl sind es rund 1.600 °C. Hinzu kommt ein enormer Abbau-, Transportund Verarbeitungsaufwand, verbunden mit Umweltzerstörungen. So stehen z. B. weltweit betrachtet zunehmend vor Ort keine geeigneten Sande zur Verfügung, die dann z. B. per Schiff um den halben Erdball transportiert werden müssen.

Was zählt, ist das Mischverhältnis: Joachim Juhart und sein Team am Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie
Optisch kein Unterschied: links ein Öko-Beton-Element, rechts ein Element aus Standardbeton1 Was zählt, ist das Mischverhältnis: Joachim Juhart und sein Team am Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie2 Optisch kein Unterschied: links ein Öko-Beton-Element, rechts ein Element aus Standardbeton
Verringerung des Zementanteils
Weltweit wird deshalb in vielen Instituten nach Möglichkeiten für die Reduzierung der Umweltbelastungen geforscht. Der Hauptansatz besteht hierbei in der Verringerung des Zementanteils bzw. der Erforschung von alternativen Bindemitteln, die sogar zu komplett zementfreien Betonrezepturen führen könnten.
So laufen z. B. an der TU Graz Forschungsprojekte, die eine Verringerung des Zementanteils durch den Zusatz von Microfüllern (Feinstoffen) und Fließmittel erreichen. Dieses Verfahren, das bei „Ultra High Performance Concrete“ (UHPC) schon seit längerem angewandt wird, sorgt für ein geringeres Wasser/Bindemittelverhältnis bei gleicher Härte und Widerstandsfähigkeit.
Alternative Betonzusatzstoffe
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von höheren Mengen an Betonzusatzstoffen wie Flugasche, Hüttensande oder Kalksteinmehl. Ihr Anteil wird von 15 % auf bis zu 50 % angehoben, wobei die Emissionen um immerhin 30 % reduziert werden können. Problempunkte sind hier jedoch die Dauerhaftigkeit, insbesondere der Carbonatisierungs-, Sulfat- und Frostwiderstand. So zeigte sich in Versuchen, dass einige der sogenannten „Ökobetone“ bisher noch deutlich schneller und stärker durch den Frost-Tau-Wechsel angegriffen werden als herkömmliche Betone. Dies beschränkt ihren Einsatz vorerst auf Innenbauteile.
Carbonbeton
Carbonbeton wird als Baustoff der Zukunft beschrieben. Er wurde an der TU Dresden entwickelt, ist viermal leichter und sechsmal tragfähiger als Stahlbeton, lässt sich flexibel formen, zudem rosten Carbonfasern nicht. Bedingt durch diese Eigenschaften reduziert sich auch der Energieaufwand für Herstellung und Transport enorm. Auf der anderen Seite gibt es noch kaum Erfahrung bezüglich des Recyclings; Beton und Carbonfasern lassen sich vermutlich schlechter trennen als Beton und Stahl. Auch sind die toxikologischen Auswirkungen beim Verarbeiten (fräsen, sägen, schleifen, schlitzen …), bei Abrissarbeiten oder im Brandfall noch wenig erforscht. So warnten Bundeswehr-Experten in einer Studie von 2014 davor, dass beim Erhitzen von Bauteilen aus Carbonfasern (CFK) bei 650 °C (Brandfall, flexen, sägen, …) Partikel entstehen, die – wenn sie eingeatmet werden – ähnlich krebserregende Wirkung haben können, wie Asbest.
IBN-Kommentar
Ökobeton und Baubiologie
Aus baubiologischer Sicht ist eine energiesparendere und umweltschonendere Betonherstellung selbstverständlich begrüßenswert. Hinzu kommt der Vorteil, dass Textilfasern – wie z. B. Carbonfasern – im Gegensatz zu Stahl das Erdmagnetfeld nicht verzerren. Es sollte jedoch auch eine genaue Prüfung aller Zusätze auf toxikologisch und ökologisch bedenkliche Inhaltsstoffe erfolgen, denn nur so wird das Material dem Titel „Ökobeton“ gerecht.
Generell sollte bei jeder Bauaufgabe geprüft werden, welche Baustoffe sich dafür aus ganzheitlicher Sicht am besten eignen.
Ihre Stimme zählt
Wir sind neugierig darauf, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass auf dieser kostenlosen Informationsplattform:
- Fragen nicht beantworten werden können – bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innen.
- Werbung nicht gestattet ist – Sie können aber gerne mit einem Werbebanner auf Ihre Produkte/Dienstleistungen aufmerksam machen
Quellenangaben und/oder Fußnoten:

Wie werde ich
Baubiolog*in IBN?
Nachhaltig weiterbilden
Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.
Unser Kompetenz-Netzwerk
Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.
Über die Baubiologie
Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.
25 Leitlinien
Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In elf Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.


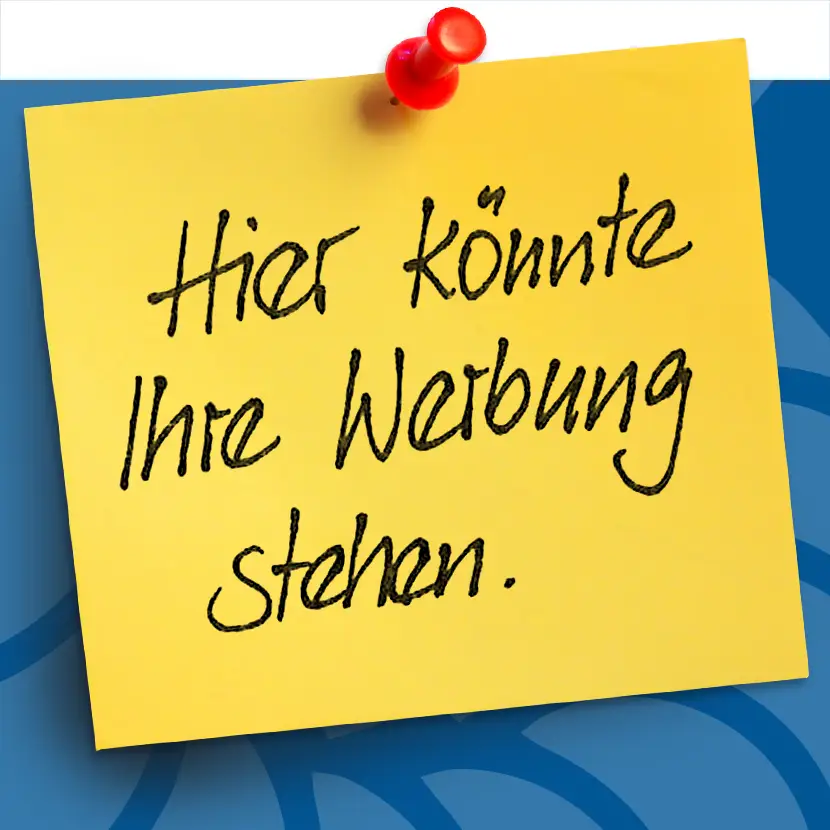
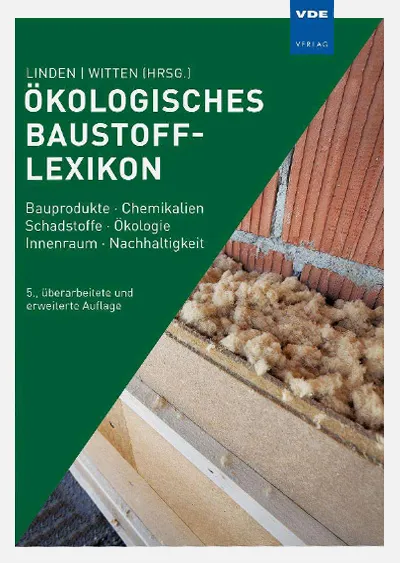
0 Kommentare