Hummelpelz als Elektrosensor – Ist Elektrosmog Mitursache für das Insektensterben?
Hummeln und andere Nektarsammler orientieren sich bei der Futtersuche an vielen verschiedenen Blütenmerkmalen, wie Farbe, Form, Muster oder Duft. Während Hummeln sich beim Fliegen positiv aufladen, ist das elektrische Potenzial der Blüte eher negativ. Die elektrostatischen Anziehungskräfte zwischen den beiden begünstigen den Pollentransfer. Je mehr Pollen deponiert wird, desto stärker ändert sich das elektrische Potenzial der Blüte. Offensichtlich verrät das elektrische Feld einer Blüte der Hummel, ob sich ein Besuch lohnt.
Bereits vor drei Jahren fanden Wissenschaftler heraus, dass Hummeln die elektrischen Felder einer Blüte wahrnehmen können. Mit dieser Fähigkeit können sie erkennen, wie oft eine Blüte bereits besucht worden ist. So vermeiden Hummeln das zeitaufwändige Anfliegen von schon geleerten Nektarkelchen.
Womit Hummeln elektrische Felder erspüren, war bisher allerdings ungeklärt. Wissenschaftler der Universität Bristol haben nun entdeckt, dass sich das Sinnesorgan für diesen Elektrosinn im Pelz der Insekten befindet. Trifft die Hummel auf das Spannungsfeld einer Blüte, werden die im Flug aufgeladenen Härchen durch die Kraft der Spannung gebeugt. Nervenzellen an der Basis der spannungsempfindlichen Haare registrieren die Auslenkung und erzeugen ein neuronales Signal, welches die Information über das Nervensystem an das Gehirn weiterleitet. Die Forscher vermuten, dass auch andere behaarte Insekten von diesem elektrosensorischen Mechanismus profitieren.
Kommentar des IBN
Für das Insektensterben und auch für das Waldsterben könnte neben Umweltgiften und Klimaerwärmung auch der zunehmende Elektrosmog eine Ursache sein. Wir fordern in diese Richtung Forschung durch unabhängige Institutionen. Gerne bringen wir hierfür unser jahrzehntelanges Wissen rund um die Baubiologische Messtechnik ein.
Ihre Stimme zählt
Wir sind neugierig darauf, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass auf dieser kostenlosen Informationsplattform:
- Fragen nicht beantworten werden können – bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innen.
- Werbung nicht gestattet ist – Sie können aber gerne mit einem Werbebanner auf Ihre Produkte/Dienstleistungen aufmerksam machen
1 Kommentar
Einen Kommentar abschicken
Quellenangaben und/oder Fußnoten:

Wie werde ich
Baubiolog*in IBN?
Nachhaltig weiterbilden
Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.
Unser Kompetenz-Netzwerk
Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.
Über die Baubiologie
Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.
25 Leitlinien
Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In elf Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.

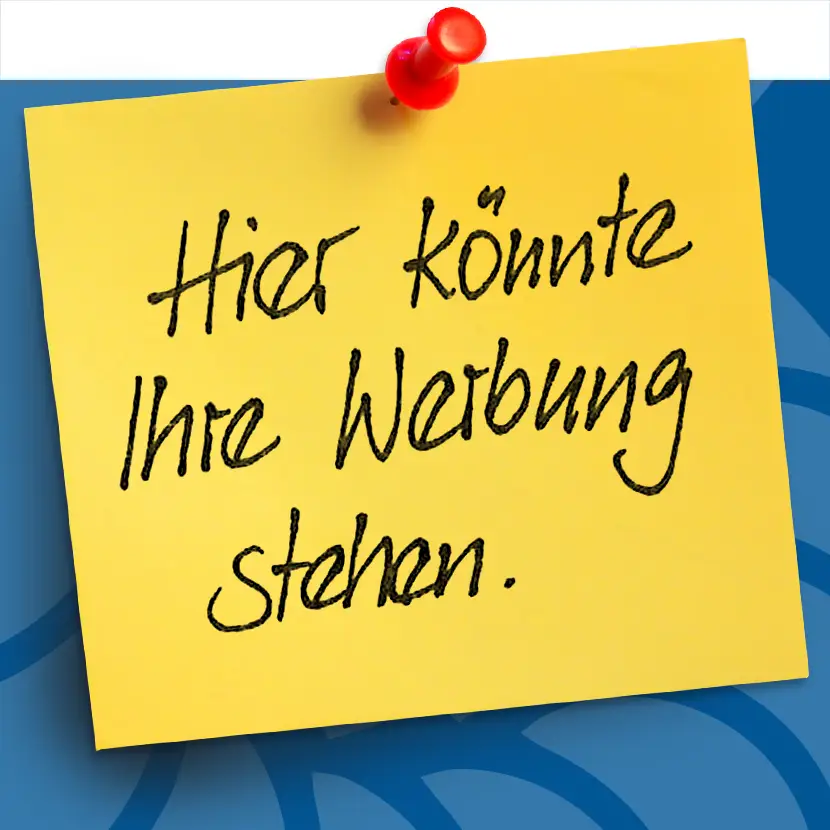
Der Biologe und Physiker Dr. Ulrich Warnke stellte bereits in den 70er Jahren fest, dass Bienen unter Einfluss niederfrequenter Felder Stressreaktionen zeigten, bei Signalen im Frequenzbereich 10-20 kHz erhöhte Aggressivität und stark reduziertes Rückfindeverhalten. Prof. Dr. Ferdinand Ruzicka sagte: „Die Probleme sind erst aufgetaucht, seit in unmittelbarer Umgebung meines Bienenstandes mehrere Sendeanlagen errichtet wurden.“ Mehr dazu bei Diagnose-Funk e.V.